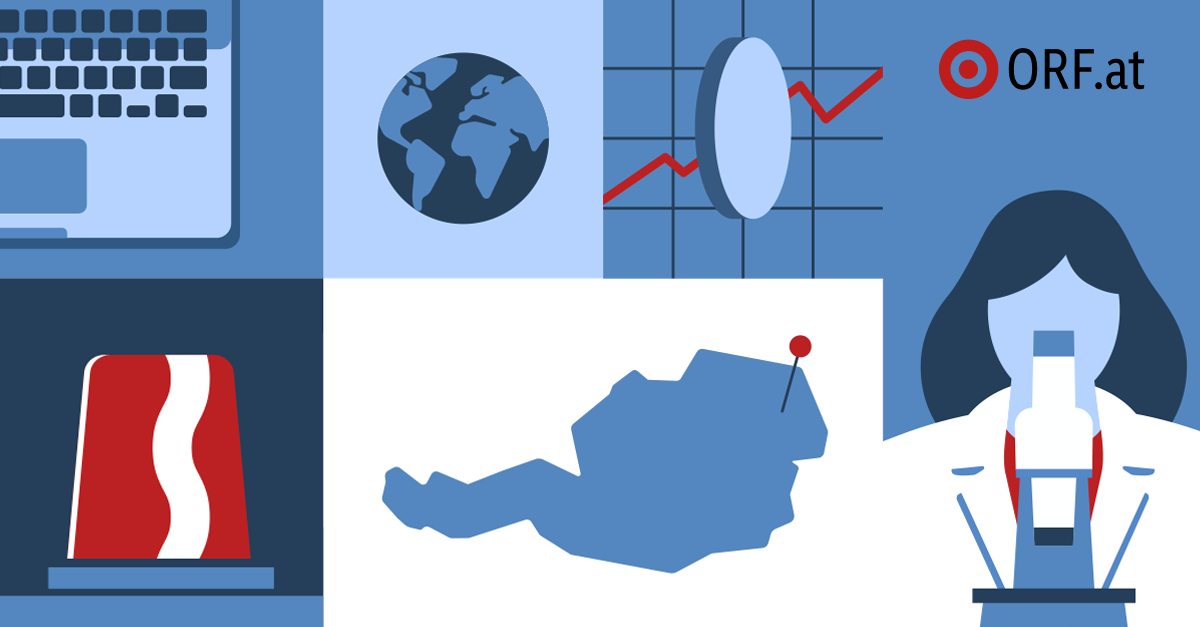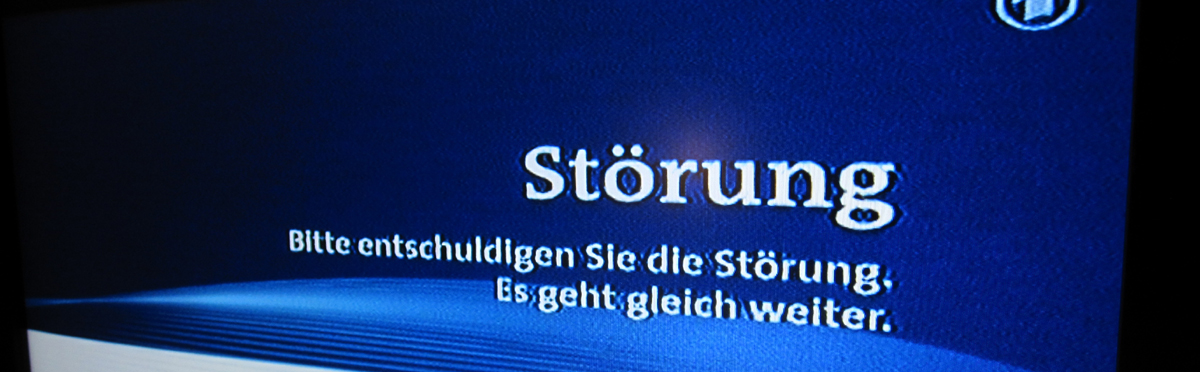Und das ist gut so und wichtig so.Denn der ÖRR kann nicht nur Programm und Übertragungswege für Boomer und noch ältere anbieten.
Er muss (so will es auch der MStV) alle BürgerInnen erreichen. Auch diejenigen, die gar kein TV-Gerät und kein klassisches Radio besitzen, aber ein Netflix-, Spotify- und DAZN-Abo haben. Diese mit politischen, kulturellen, gesellschaftlich relevanten Inhalten zu erreichen ist die Aufgabe.
Womit ich ein Problem habe: Inhalte exklusiv für das Web zu produzieren, während die linearen Programme auf den klassischen Verbreitungswegen ausgedünnt werden bzw. "seichte" Inhalte Sendezeit wegnehmen, die man mit Relevantem hätte füllen können.
Es gibt auch nach wie vor Menschen, die "offline" sind. Die geistig extrem fitte und aktive 96-jährige Raumakustikerin des Rundfunks der DDR beispielsweise - die ruft mich dann an, damit ich ihr Informationen aus dem Internet besorge, auf die im linearen Programm nur hingewiesen, die dort aber nicht gesendet wurden. Auf Internet hat sie verzichtet - in diesem Alter wollte sie sich das nicht mehr aufhalsen. Am Geld hätte es nicht gelegen. Sie arbeitet offline am alten Laptop ihres vor zig jahren verstorbenen Mannes. Und ruft mich auch mal nach Mitternacht an, wenn ihr Word "spinnt". Im Extremfal bin ich dann schon aufs Fahrrad gestiegen und noch hingefahren.
Oder meine Mutter, Mitte 80, ebenfalls geistig absolut fit. Ihr TV-Programmspeicher enthält nur öffentlich-rechtliche Programme. Sie ist sauer darüber, wenn im Fernsehen nur ein Hinweis auf für sie wichtige Informationen kommt, selbige aber für sie nicht zugreifbar sind, da sie mit menübedienten Geräten nicht klarkommt (ich habe das über 20 Jahre lang vergeblich versucht, ihr beizubringen, vergeblich, es endet in Weinanfällen, Panikattacken etc.).
Schaue ich mir den Freundeskreis meiner Mutter an, sieht es da nicht anders aus. Da können manche zwar via Whatsapp mit den Enkeln kommunizieren (und haben von Datenschutz nicht die leiseste Ahnung), aber die Kompetenz, nach Informationen und Medieninhalten im Netz zu suchen, die haben sie nicht. Und die werden sie auch nicht mehr erlangen. Das Problem löst sich "biologisch" in vielleicht 10 Jahren, aber wenn ich mir die Statistik hier

Rund 3,8 Millionen Bundesbürger leben offline
Für die meisten Bundesbürger ist das Smartphone unverzichtbarer Bestandteil ihres Alltags. Doch auch in Deutschland leben noch immer viele Menschen, die keinen Internetzugang haben oder bewusst auf Online-Angebote verzichten.
anschaue, dauert es vielleicht auch noch länger: schon bei den 65- bis 74-jährigen sollen demnach ca. 20% offline sein. Auch das sind Beitragszahlende!
Das, was sich für ein lineares Programm eignet, auch primär für das lineare Programm zu produzieren und zusätzlich so lange es medienrechtlich (Stichunkt Depublikation) möglich ist, auf Web-Plattformen vorzuhalten, wäre mein Weg der Wahl. Aber bitte so vorhalten, dass es auch gut auffindbar ist.
Dazu ein Auszug aus einer Korrespondenz, die sich außerhalb des Forums im privaten Umfeld in den vergangenen Tagen ergeben hat. Das Thema wird nämlich durchaus auch in "nicht-Cyber-Kreisen" diskutiert. Der Mann ist um die 30, hat ein naturwissenschaftliches Studium absolviert, interessiert sich für gesellschaftliche Entwicklungen ebenso wie für Kultur. Er ist IT-Experte und schrieb mir folgendes zur ARD-Mediathek:
Und es fehlen völlig die (offiziellen) offenen Schnittstellen, um von außen drauf zuzugreifen. Seien es Plugins für Mediencenter, die sich mit dem Bestand synchronisieren können oder einfach nur RSS. Die
Mediatheken sind daher nicht mit meinem Medienkonsum vereinbar, es sei denn ich suche ganz gezielt etwas.
Man will die Kunden [...] ins eigene geschlossene App-Ökosystem zwingen, statt die Datenbank zu öffnen, [...] Wenn sie damit Geld verdienen müssten, könnte ich es nachvollziehen. Aber der Rundfunk ist bereits bezahlt und hat gefälligst für alle niederschwellig da zu sein.
Und:
Achso, der Sonderpreis für Unübersichtlichkeit und Unbenutzbarkeit von Websites geht an die Gestalter bei SWR und WDR. Es scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, klar aufzulisten, welche bereits gelaufenen Jazzsendungen nachhörbar sind. Alles ist durcheinander mit zukünftigen Sendungen, Podcastreihen, Personality-Gedöns, Veranstaltungstips. Und wenn man nicht aufpasst, fallen alte Sendungen in der Liste hinten runter. [...] So wie die öffentliche Verwaltung gnadenlos an der Digitalisierung ihrer Vorgänge scheitert, weil sie Dinge, die analog schon nicht funktionieren, blind kopiert [...], so scheitert auch die ARD an sich selbst.
Da gibt es also tatsächlich noch Entwicklungs- und Optimierungspotential. Geld, das dort gewinnbringend investiert wird, halte ich auch für gut angelegt.
Wenn ich - den Hörfunk betreffend - mal durchs Land schaue und z.B. bei meiner "Heimatanstalt" MDR etwas genauer hinblicke, finde ich fast gar nichts, das den Begriffen "intellektuelles Publikum" und "schützenswerte Hochkultur" entsprechen könnte. Selbst MDR Kultur bietet so etwas bei weitem nicht durchgehend. Und hinsichtlich Abdeckung kultureller Bereiche / Genres fehlt im linearen Hörfunkprogramm des MDR extrem viel, zum Beispiel fast die gesamte Popkultur.Es ist nicht die Aufgabe, nur das zu senden, was das intellektuelle Publikum für schützenswerte Hochkultur hält!
Das Resultat fällt, wenn ich mir die anderen Anstalten anschaue, nur teilweise anders aus. Man hat auf UKW teils 4 Unterhaltungswellen für unterschiedliche Altersgruppen, aber mit gleichem "kaum-Inhalt-und-nur-Hintergrundberieselung"-Konzept, dazu eine Infowelle und die Kulturwelle, die irgendwie alles aufnehmen muss, was wegen der Radikalformatierung auf "Quote" auf den anderen Wellen nicht mehr vorkommen darf. Und dann laufen selbst dort teils noch stundenweise "Füllstoff" bzw. zeitnahe Wiederholungen.
Da sich Radiohörer beim Hören des gleichen Programms nicht gegenseitig die Inhalte wegnehmen, sondern unabhängig voneinander hören können, muss größeren Interessengruppen nicht mehr Sendezeit zur Verfügung gestellt werden als zahlenmäßig kleineren Interessengruppen. Das ist keine Erkenntnis von mir, das hat Urs Frauchiger aus der Schweiz schon vor Jahrzehnten gesagt:
„Wenn ein Hörer Schönberg hören möchte und hundert James Last, dann heißt die Lösung nicht, eine Stunde Schönberg senden und hundert James Last, sondern eine Stunde Schönberg und eine Stunde James Last.“ So erhält jeder Einzelne eine Stunde lang seine Musik, das sei, so Frauchiger, „wahre Demokratie“, weil sie auch der Minderheit zu ihrem Recht verhilft.
(eine der Quellen, die dieses Zitat sinngemäß wiedergibt, ist diese.
Es geht nicht um "ausschließlich Hochkultur", es geht zuallererst mal bei den Unterhaltungswellen um eine Wiederherstellung eines Zustandes, der es denen, die diese Programme nutzen, ermöglicht, Horizonterweiterungen statt Horizonteinschränkungen zu erfahren. Und der es ermöglicht, in diesen Programmen aufgrund vorhandener und relevanter Wortbeiträge die humanistische Haltung wieder zu erkennen, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk einst nach dem 2. Weltkrieg ins Leben gerufen wurde.
Die gesellschaftlich und kulturell wertvollen Bestandteile, die heute noch im Gesamt-Angebot der ARD-Anstalten vorhanden sind, müssen dazu zuallererst geschützt werden.
Was ist "das eine", das zu tun ist, ohne "das andere" (Kultur?) zu lassen?Aber das eine zu tun und das andere nicht zu lassen, unter finanziell schwieriger werdenden Rahmenbedingungen ist das Problem.
Ganz ehrlich: dass in Wellen wie Bayern 2, WDR 3, SWR 2, WDR 5 oder auch Radio Eins und in der Musikredaktion, die die "Nachtclub"-Sendungen auf NDR Blue betreut, so gearbeitet wird, halte ich als Außenstehender für sehr naheliegend. Beim quotenstarken ARD-Unterhaltungsfunk fehlt mir dazu aber jede Phantasie. Ich habe im Herbst 2021 einiges an ARD-Popfunk gehört - aus technischen Gründen. Ich war schockiert, dass es noch viel niveauloser geht als vor 10-15 Jahren, als ich mich vom Popfunk verabschiedet habe.Und das wird jeden Tag in den Sendern verhandelt, mit viel Herzblut und Hirn. Auch wenn sich das einige hier offensichtlich nicht vorstellen können. Worüber ich manchmal echt schockiert bin.
Das kann aber auch für die Sendung und gegen die Menschen sprechen. Schade wäre es trotzdem. Das gern strapazierte "die Menschen dort abholen, wo sie sind", wird allerdings hier und da durchaus auch als intellektuelle Beleidigung und Herabwürdigung empfunden. Habe ich in meinem Bekanntenkreis vor Jahren auch in Diskussionen erlebt.Mal, weil es so wenig Menschen erreicht hat, dass es verschwendetes Geld und verschwendete Energie war.
Solange diese Inhalte nicht auch noch wegrationalisiert werden, wäre das ja schonmal ein guter Anfang. Es ist - meine Erfahrung - aber auch beim anstaltsübergreifenden Hören (und das konnte ich seit ich im Jahre 2000 ein Astra Digital Radio kaufte) aber zumindest in dem Bereich, in dem ich die längste Zeit meine Interessen hatte, schon deutlich weniger geworden.Und wenn man ein Format in einem Sender nicht mag - egal, denn es gibt etliche andere Programme und Sender, die Mediathek und die Audiothek, die sicherstellen, dass ich zu jeder Stunde des Tages etwas im ÖRR-Portfolio finden kann, DAS ich mag.